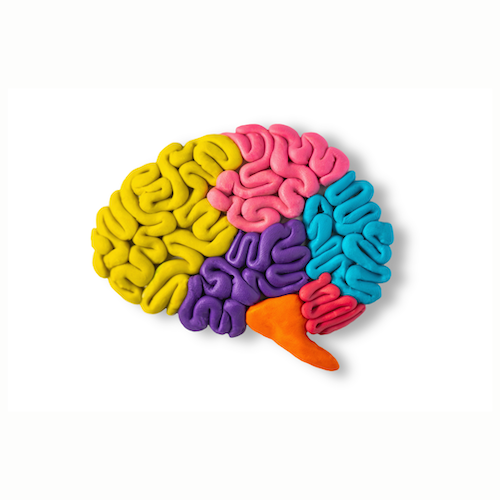Das Buch „Typologie“ enthält mehrere Schriften oder Teile davon, die zwischen 1921 und 1936 erschienen sind. Jung unterscheidet zwischen einem Introversions- und einem Extraversionstypen. Bei ersterem ist das Leben durch sein Inneres, durch sein seelisches Geschehen bedingt. Bei zweiterem ist es der Einfluss des Äußeren, der das Leben bestimmt. Immer hat entweder der introvertierte oder der extravertierte Standpunkt in einem menschlichen Leben den Vorrang. Das heißt, dass der jeweilige Mensch lebenslang von einem Standpunkt übermäßig eingenommen ist. Jung geht aber weiters davon aus, dass der Mensch grundsätzlich nach einem Gleichgewicht zwischen Extraversion und Introversion strebt. Das bedingt wiederum, dass der jeweilige Typus, der vorherrscht, durch seinen Gegenpart im Unbewussten kompensiert wird. „Eine rhythmische Abwechslung beider psychischer Tätigkeitsformen dürfte dem normalen Lebenslauf entsprechen.“
Wissenschaftstheoretische Überlegungen
Für Jung sind seine Überlegungen zur Typologie wissenschaftstheoretische Überlegungen. Er möchte mit Hilfe dieser Theorie, die Fülle von Einzelbeobachtungen ordnen können. Seine Vorgangsweise ist dabei aber nicht deduktiv. Er deduziert dieses Schema nicht a priori von einem feststehenden Grundgesetz. Er nimmt den induktiven Weg, das heißt aufgrund der vielen Erfahrungen von Einzelbeobachtungen fand er zu dieser Ordnung.
Funktionstypen
Die Unterscheidung zwischen introvertiertem- und extravertiertem Standpunkt ist aber nicht die einzige, die Jung trifft. Er unterscheidet weiters die vier Funktionstypen Denken, Fühlen, Empfindung und Intuition, die jeweils extravertiert oder introvertiert ausgeprägt sein können.
Das Verhältnis von Leib und Seele
In seiner Einleitung greift Jung auch das Thema des Verhältnisses zwischen Leib und Seele auf. Er skizziert auf wenigen Seiten wie im Laufe der kulturgeschichtlichen Entwicklung eine differenzierte Sichtweise zwischen Geist, Seele und Leib entstand und wie auch in dieser Entwicklung diese Dimensionen letztlich auseinander gerissen und einseitig betont wurden. Wegweisende Marken waren dabei die griechische Philosophie, die jüdische Prophetie, die Entstehung des Christentums und das Aufkommen des neuzeitlichen Wissenschaftsverständnisses. Das Einsetzen der differenzierten Sicht von Geist und Leib entstand innerhalb der griechischen Philosophie im Bewusstwerden der menschlichen Vernünftigkeit und damit der Möglichkeit ethisch und moralisch Verantwortung zu übernehmen. Der Mensch trat aus dem mythischen ganzheitlichen Erleben heraus. Die vernünftige und seelische Dimension wurde im Christentum und in einer vom Platonismus überbetonten Philosophie übermäßig herausgehoben und der Leib minder bewertet. Das Aufkommen des neuzeitlichen Wissenschaftsbegriffes gab in gewisser Weise der Materie wieder seine Würde zurück, in dem sie der bevorzugte Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung wurde. Hingegen setzt die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Seele erst sehr spät an. Aber auch auf diesem Gebiet gibt es den Ansatz, die seelischen Erscheinungen nur auf den Körper und seine Funktionen zurück zu führen. So moniert Jung gegenüber Freud, dass auch er die seelischen Erscheinungen eigentlich auf den körperlichen Trieb der Sexualität reduziert hat.
Jung geht von der „Eigengesetzlichkeit der Seele“ aus und macht diese zum Gegenstand seiner Forschung. Er will nicht Seelisches auf Körperliches reduzieren, sondern er untersucht die seelische Landschaft sui generis. Die Typen, die er herausarbeitet sind für ihn „Formen seelischer Strukturelemente“.
Mit seiner Typologie versucht Jung zum einen eine kritische Psychologie zu gründen, die methodisches Handwerkszeug zur Verfügung stellt, um die Fülle der Phänomene zu ordnen. Zum anderen dient ihm die Typologie dazu, die Selbstwahrnehmung des Arztes oder des Therapeuten zu schärfen, um einen gemäßen Umgang mit den Patienten zu ermöglichen.
Einstellungs- und Funktionstypen
Jung unterscheidet also zwischen Einstellungstypen und Funktionstypen. Die Einstellung eines Menschen ist entweder intro- oder extravertiert. Diese Einstellung zeigt die Richtung der Libido an. Wobei für Jung die Libido nicht nur der sexuelle Trieb ist, sondern Jung meint mit Libido die Fülle der seelischen Lebensenergie, in der der sexuelle Trieb eine wesentliche Rolle spielt. Der extravertierte Typ richtet seine Libido auf das Objekt und der introvertierte Typ entzieht dem Objekt seine Libido und richtet sie nach innen. Nun ist es aber so, dass die extravertierte oder introvertierte Einstellung in einem Menschen immer verbunden ist mit dem Vorrang einer der vier Funktionen (Denken, Fühlen, Empfinden, Intuition). Für Jung ist also jeder Mensch charakterisiert durch erstens das Vorherrschen einer der vier Funktionen, die zweitens immer extravertiert oder introvertiert gerichtet ist. „In Wirklichkeit gibt es nicht Introvertierte und Extravertierte schlechthin, sondern es gibt introvertierte und extravertierte Funktionstypen, wie Denktypen, Empfindungstypen und so weiter.“
Die fundamentale Unterscheidung zwischen Extra- und Introversion ist für den Menschen nicht frei wählbar. Jung betrachtet sie als biologisch disponiert. Die biologische Grundlage sieht Jung im evolutionären Anpassungsmechanismus, der entweder durch eine hohe Fruchtbarkeit und durch viele Kontakte oder durch eine niedrigere Fruchtbarkeit und daher auch durch eine starke Entwicklung der individuellen Position geprägt ist. Jung geht davon aus, dass diese biologische Disposition nicht mehr geändert werden kann und grundsätzlich von jedem Menschen entwickelt werden soll. Kommt es aus irgendwelchen Gründen dazu, dass der jeweilige Typus nicht entfaltet werden kann oder gar der gegenteilige Typus aufgrund widriger Bezugspersonen gelebt werden muss, besteht die Heilung darin, den angeborenen Einstellungstypus zur Entfaltung zu bringen. Die willentliche Umkehrung von Einstellungstypen in einer Person führt nach Jung oft zu einer psychischen Störung wie bspw. starker Erschöpfung.
Die allgemeine Einstellung des extravertierten Typus
Jung unterscheidet in seiner Vorgehensweise der Darstellung der Einstellungstypen immer exakt zwischen einer Psychologie des Bewussten und einer Psychologie des Unbewussten. Um die Darstellung zu erleichtern, beginnt er jeweils mit der Darstellung der Psychologie des Bewussten, das heißt er beginnt mit der Beschreibung jener Phänomene der Einstellung, die dem erlebenden Subjekt bewusst wahrnehmbar sind.
Für den extravertierten Typus ist das Objekt die determinierende Größe schlechthin. Die Libido ist auf das Objekt gerichtet und dem Objekt kommt alle Erwartung zu. Interesse und Aufmerksamkeit folgen den Personen und Dingen in der nächsten Umgebung. Das erkennbare Handeln ist immer auf die objektiven Verhältnisse bezogen und achtet die realen Verhältnisse und richtet sich in ihnen ein. „Die moralischen Gesetze des Handelns decken sich mit den entsprechenden Anforderungen der Sozietät respektive mit der allgemein geltenden moralischen Auffassung.“ Die extravertierte Einstellung sucht meistens eine optimale „Einpassung“ an die gegebenen Verhältnisse.
Jung unterscheidet in seiner Typologie zwischen Einpassung und Anpassung. Mit „Einpassung“ bezeichnet Jung die konkrete Angleichung an eine konkret-geschichtliche Situation, die aber nicht immer eine ideale „Anpassung“ ist, weil sie bspw. ethischen Idealen nicht entspricht.
Die subjektiven Bedingungen kommen beim extravertierten Typ zu kurz. Ein extravertiertes Bewusstsein kann sich so in die gegebenen Verhältnisse „einpassen“, dass seelische und leibliche Bedürfnisse vollkommen unberücksichtigt bleiben. Das Subjekt und subjektive Bedingungen werden den objektiven Verhältnissen geopfert. Für den extravertierten Typus besteht die Gefahr, dass das Subjekt vollkommen ins Objekt gezogen wird. Der Körper reagiert dann mit leiblichen Symptomen, um das bewusste Verhalten zu kompensieren.
Die Einstellung des Unbewussten
Jung konstruiert das Verhältnis zwischen Bewussten und Unbewussten so, dass das Unbewusste im Menschen die bewusste Einstellung mit der gegenteiligen Einstellung kompensiert. Das Unbewusste versucht durch introvertierte Symptome das Verhältnis zwischen Bewussten und Unbewussten wieder auszugleichen. Das heißt, dass der extravertierte Typ eine stark egozentrische Tendenz des Unbewussten aufweist, da aufgrund seiner bewussten Haltung viele Wünsche und Neigungen unterdrückt werden. Besonders auf den extravertierten Typ trifft das Wort Freuds zu, dass das Unbewusste nur wünschen kann.
Je weniger die Wünsche und Neigungen von der bewussten Einstellung des extravertierten Typus anerkannt werden, desto infantiler und archaischer treten sie im Unbewussten auf. Beim „Normaltypus“ der Extraversion kompensiert das Unbewusste im alltäglichen Leben.
So kann es bei einer Person, die in ihrem bewussten Verhalten in einem sehr sensiblen Rapport mit der Umwelt steht, durch das Unbewusste oft zu spontanen taktlosen Äußerungen kommen. Kommt es aber zu einer Übertreibung der extravertierten Einstellung, so tritt die introvertierte Richtung des Unbewussten in offene Opposition zur Einstellung des extravertierten Typus und nimmt einen destruktiven Charakter an, der zum subjektiven und objektiven Zusammenbruch führen kann.
Für Jung kommt nun aber die extravertierte Einstellung immer nur im Zusammenhang mit einer der vier Grundfunktionen (Denken, Fühlen, Empfinden, Intuition) der menschlichen Psyche zum Tragen. Jung geht davon aus, dass in der konkreten Person immer eine dieser vier Grundfunktionen den Vorrang besitzt, sozusagen der „Hauptkanal der Lebensenergie“ ist und die anderen Funktionen entweder sekundär oder unbewusst dazugeordnet sind.
Der extravertierte Denktypus
Das Denken des Extravertierten ist an den äußeren Maßstäben gerichtet. Es orientiert sich an objektiven Ideen oder sichtbaren Gegebenheiten. Diese Art zu Denken scheint immer durch das objektiv Gegebene bewirkt zu sein. Die Reflexion auf die subjektiven Bedingungen des Denkens oder der Erkenntnis sind ihm lästig und vernachlässigbar. Das Denken des extravertierten Typus steht in Gefahr sich mit Ideen, Theorien, Anschauungen vollkommen zu identifizieren. Das „man sollte eigentlich“ spielt führ ihn eine große Rolle. Wenn diese Form des extravertierten Typus weit genug ist, gehen daraus Reformatoren oder Neuerer hervor. Je enger die Form dieses Denkens wird, desto eher besteht die Gefahr, dass es Nörgler, Vernünftler, selbstgerechte Kritiker und Fundamentalisten gebiert. Im innersten Kern dieses Denkens gibt es nichts Konkret-Lebendiges. Alles Persönliche, Lebendige, Gefühlsmäßige ist tot; es ist dem Ideal unterworfen. „In erster Linie werden es bei diesem Typus alle vom Gefühl abhängigen Lebensformen sein, welche der Unterdrückung verfallen, also zum Beispiel ästhetische Betätigungen, der Geschmack, der Kunstsinn, die Pflege der Freundschaft und so weiter. Irrationale Formen, wie religiöse Erfahrungen, Leidenschaften und dergleichen sind oft bis zur völligen Unbewusstheit ausgetilgt.“ Kommt es zu einer Totalidentifikation zwischen bewusstem Ich und dem Objekt wird die Person dogmatisch starr. Als Beispiel so eines Denkens nennt Jung das Theosophische Denken, für das es keine Rätsel in der Wirklichkeit mehr gibt, da alles immer schon erklärt ist.
Die Verdrängung der Gefühle in das Unbewusste ist eine Folge der übersteigerten extravertierten Einstellung. Durch das Unbewusste kann es aber zu höchst minderwertigen Gefühlsreaktionen kommen, die das ethische Ideal empfindlich desavouieren können. Eine weitere Folge ist die Vernachlässigung der seelischen und leiblichen Bedürfnisse der eigenen Person. Auch die nächste Umgebung, die eigene Familie kann ganz in den Dienst des Ideals genommen werden.
„So großartig die individuelle Aufopferung für das intellektuelle Ziel auch sein mag, so kleinlich, misstrauisch, launisch und konservativ sind die Gefühle.“ Im Unbewussten sammeln sich die verdrängten Gegenpositionen, wie kleinlicher Zweifel oder archaische und infantile Bedürfnisse. Beim Mann ist es oft so, dass der Zweifel, der ins Unbewusste verdrängt wird, durch einen übersteigerten Fanatismus überkompensiert wird.
Der introvertierte Denktypus
Menschen mit einer introvertierten Einstellung orientieren sich grundsätzlich am eigenen Subjekt. Die Richtung der Libido zielt nicht auf das Objekt, sondern wird von ihm abgezogen (abstrahiert) und auf das eigene Erleben, Denken und Fühlen gerichtet. Der Umgang mit sich selbst bereitet dem introvertierten Menschen Vergnügen. Letztlich gültig ist dem introvertierten Typus seine eigene subjektive Welt. Von außen betrachtet wirken diese Menschen oft neidisch, misstrauisch, unzugänglich, kühl und abweisend. Das seelische Leben bleibt der Umwelt verborgen.
Das introvertierte Denken orientiert sich in erster Linie am subjektiven Faktor. Dieses Denken beginnt im Subjekt und führt zum Subjekt zurück. Es zeigt sich den Tatsachen gegenüber immer reserviert, es schafft hingegen gerne neue Fragestellungen, immer wieder neue Theorien und ist immer interessiert an der Entwicklung einer subjektiven persönlichen Idee. Das introvertierte Denken bezieht seine Kraft aus dem Unbewussten, aus dem Archetypus, „der als solcher allgemeingültig und wahr ist und ewig wahr sein wird.“ Die objektive Welt ist diesem Denken immer nur der Anlass zur Realisierung der inneren Gedanken, Bilder und Vorstellungen. In Folge einer übertriebenen Einstellung dieses Denktypus kann es zu einer Verarmung des Denkens kommen, da die objektive Welt vollkommen vernachlässigt wird.
Aus dem Bereich der Wissenschaft nennt Jung Charles Darwin als einen pointierten Vertreter eines extravertierten Denkens und Immanuel Kant als einen Vertreter des introvertierten Denkens. Dem introvertierten Denken geht es immer mehr um die subjektiven Bedingungen von Erkenntnis, es strebt immer mehr nach Vertiefung als nach Verbreitung.
Das Urteil von introvertierten Denktypen erscheint der Umwelt oft als kalt und rücksichtslos. Sie lassen gerne eine gewisse Überlegenheit durchfühlen und denken die kühnsten ketzerischsten Gedanken. In der Umsetzung befällt sie oft Ängstlichkeit und meistens zeichnet sie ein enormer Mangel an praktischen Fähigkeiten aus. Eine ausgesprochene Abneigung gegen Werbung und Reklame ist ebenso charakteristisch für das introvertierte Denken. Das Gespür und das Gefühl für den richtigen Zeitpunkt und die richtige Platzierung eines Gedankens in einem konkreten Umfeld, fehlt dem introvertierten Denktypus. „So klar ihm die innere Struktur seiner Gedanken ist, so unklar ist ihm, wo und wie sie in die wirkliche Welt hineingehören.“
Das Auftreten von introvertierten Denktypen wird oft als unbekümmert und naiv wahrgenommen. Aufgrund der Sicherheit der eigenen Gedanken erscheinen seine Meinungen als autoritär und rücksichtslos. Kommt es zu einer Übersteigerung der Introversion im Bereich des Denkens, passiert eine völlige Identifizierung mit den subjektiven Ideen und Bildern. Das Denken bekommt dann einen Zug zum Mythologischen, da der Objektbezug immer mehr an Bedeutung verliert.
Die unbewusste Einstellung des introvertierten Denktypus
Kommt es zu einer übermäßigen Erhöhung des bewussten introvertierten Denkens, reagiert das Unbewusste mit einer starken oppositionellen gefühlsmäßigen Bindung an das Objekt, dass die Überlegenheitsphantasien des Ichs zerstört. Indem die bewusste introvertierte Einstellung die Überlegenheit und Freiheit des Bewusstseins sichern will, kommt es zu einem intensiven aufreibenden inneren Kampf zwischen den Machtphantasien des Ichs und der Angst vor den gefühlten Abhängigkeiten der „gewaltig belebten Objekte“ im Unbewussten. „Je mehr sich das Ich alle möglichen Freiheiten zu sichern sucht, …desto mehr gerät es in die Sklaverei des objektiv Gegebenen. Die Freiheit des Geistes wird an die Kette einer schmählichen finanziellen Abhängigkeit gelegt, die Unbekümmertheit des Handelns erleidet ein ums andere Mal ein ängstliches Zusammenknicken vor der öffentlichen Meinung, die moralische Überlegenheit gerät in den Sumpf minderwertiger Beziehungen, die Herrscherlust endet mit einer kläglichen Sehnsucht nach dem geliebt werden.“
Weitere rationale und irrationale Funktionstypen
Im Weiteren beschreibt Jung den extra- und den introvertierten Fühl-, Empfindungs- und Intuitionstypus. Er bezeichnet die Funktionstypen des Denkens und Fühlens als rationale Typen, da sie sich auf vernünftig urteilende Funktionen gründen. Das Überwiegen des einen oder anderen Faktors ist durch die psychische Disposition bedingt. Ist das Denken der primäre und bewusste Hauptkanal der Energie ist das Fühlen immer die unbewusste Kompensation zu dieser Funktion und umgekehrt. Fühlen und Denken schließen sich in der Gleichzeitigkeit der Betätigung nach Jung aus. Als irrationale Funktionstypen bezeichnet Jung das Empfinden und die Intuition. Mit Empfindung meint er die Wahrnehmung durch die fünf Sinne und die Körperwahrnehmung. Mit Intuition verbindet Jung „eine Art instinktiven Erfassens“ innerer wie äußerer Inhalte. Sie gilt ihm als die vierte Grundfunktion der menschlichen Psyche. Auch das Empfinden oder die Intuition können als Primärfunktion der Hauptkanal menschlicher Lebensenergie sein, wobei auch sie sich im Bewusstsein wechselseitig ausschließen und im Unbewussten kompensieren.
Reflexion
Jung macht in seinen Schriften zur Typologie mehrere Bezüge zur Philosophie und stellt fest, dass es auch innerhalb der Geschichte der Philosophie sozusagen einen introvertierten und einen extravertierten Denkstrom gibt. Mehrere gegenwärtige DenkerInnen unterscheiden in der Philosophiegeschichte ein metaphysisches und ein bewusstseinsphilosophisches Paradigma. Das Metaphysische Paradigma geprägt vor allem durch Platon, Aristoteles und die christliche Rezeption dieser Denker bis zum Beginn der Neuzeit wäre im Sinne Jungs gekennzeichnet durch die Orientierung an der Objektivität, an der Möglichkeit objektiver Erkenntnis von Ideen und Wahrheiten. Erkenntnis im Sinne Platon orientiert sich an der Vorstellung der vollkommenen Idee, an der die menschliche Vernunft teilhat und somit Wirklichkeit erkennen kann. Wahrheit wird bestimmt als „adaequatio rei et intellectu“, als Übereinstimmung der Vernunft mit der Wirklichkeit.
Mit der Wende zum Subjekt verschieben sich die philosophischen Interessen. Bei Kant und Hume geht es bspw. nicht mehr um die objektive Erkenntnis an sich, sondern um die subjektiven Bedingungen menschlichen Erkennens. Die mittelalterliche Philosophie der Metaphysik transformierte sich in die neuzeitliche Bewusstseinsphilosophie, deren archimedischer Punkt das denkende Subjekt war. Diese Wende zum Subjekt vollzog sich in der erkenntnistheoretischen, der praktischen als auch in der ästhetischen Dimension von Philosophie. So unterzieht Kant in seinen drei Kritiken (der theoretischen, der praktischen und der ästhetischen Vernunft) das Erkennen einer genauen Analyse, was die subjektiven Bedingungen dieses Erkennens sind und wie weit die objektive Gültigkeit dieses Erkennens reicht. Der Beginn der neuzeitlichen Philosophie ist also gekennzeichnet durch eine im Jungschen Sinne introvertierte Einstellung zum Subjekt. Eine differenzierte Darstellung der jeweiligen Epoche würde auch zutage bringen, dass die jeweiligen Hauptströmungen immer durch gegenteilige Strömungen in Kunst, Musik und Wissenschaft sozusagen kompensiert worden sind. So steht in der Neuzeit bspw. dem subjektorientierten bewusstseinsphilosophischen Paradigma in der Philosophie eine stark am objektiv Gegebenen orientierte Naturwissenschaft entgegen.