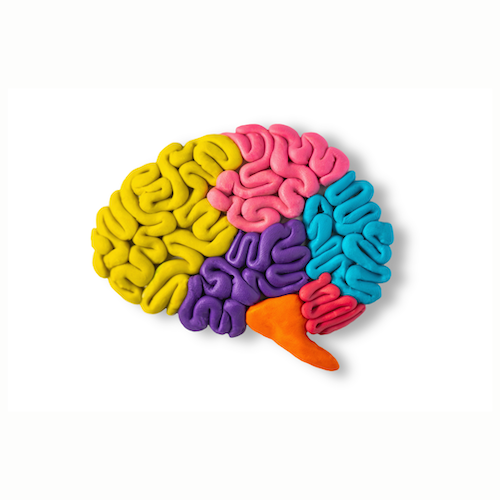Steve de Shazer legt in seinem Buch „Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzeittherapie“ den Fokus vermehrt auf das Therapieinterview selbst. In den zwei vorangegangenen Bücher „Keys to Solution in Brief Family Therapy (dt. Wege der erfolgreichen Kurztherapie)“ und „ Patterns of Brief Family Therapy lag die Aufmerksamkeit der Reflexion auf den Aufgaben, die jeweils am Ende des Gesprächs vom Therapeuten oder vom Team den Klienten gegeben wurden, um Lösungen zu initiieren. Im hier besprochenen Buch beschreibt nun de Shazer die Fokusverlagerung der Reflexion und damit auch der Bewertung und Gewichtung des Interviews von den Aufgaben am Ende des Gesprächs hin zur vermehrten Beobachtung des Gesprächs selbst.
De Shazer betrachtet die Therapiesituation selbst als System. Mit seinem Team will er die „Therapie-als-System“ und nicht die „objektive“ Familie-als-System beobachten und beschreiben. In der Therapiesituation haben wir es mit einer sozialen Realität zu tun, die vom Klient (von den KlientInnen) und vom Therapeut konstruiert wird und deren Bedeutungen verhandlungsfähig sind.
Dieser Fokusverlagerung von den Aufgaben zum Therapieinterview verfolgt aber ein ganz bestimmtes Interesse. De Shazer möchte in seinem Buch eine möglichst präzise Theorie der Lösung skizzieren. In den Therapieinterviews entdeckten er und sein Team, dass nicht nur die lösungsorientierten Aufgaben am Ende des Gesprächs, sondern bereits das Fokusieren auf die Ausnahmen vom Problem während des Gesprächs die Lösungsfindung beschleunigten.
Die Ausnahme vom Problem
Steve de Shazer und sein Team fokusieren in ihren Therapiegesprächen sehr stringent auf die Lösung eines dargestellten Problems und verbringen keine Zeit das Problem zu analysieren. De Shazer vertritt die für viele TherapeutInnen provokante These, dass man das Problem nicht kennen muss, um eine Lösung zu finden. Er vergleicht die Schilderungen des Klienten mit einer Landkarte. Diese Landkarte ist mit der Landschaft selber, dem Leben des Klienten nicht zu verwechseln. Im Leben des Klienten mag es zwar viele Problembereiche geben, de Shazer zielt aber darauf ab, einen möglichst kurzen und geradlinigen Weg zur Lösung in der Landkarte des Klienten zu finden. Trotzdem haben wir im Therapiegespräch nichts anderes zur Verfügung als die vom Klienten geschilderte Landkarte. Auf dieser geschilderten Landkarte gilt es nun den schmalen oder breiten Pfad zur Lösung des Problems einzuzeichnen, den der Klient bereits gegangen ist, oder geht, oder möglicherweise gehen könnte. Dieser Lösungspfad wird wesentlich durch bereits bestehende Ausnahmen vom Problem, die im Gespräch aufgedeckt werden, konstruiert. Mit dieser Vorgehensweise ist nicht gesagt, dass es nicht auch den weiten Bereich des Problems und seiner möglichen Gründe und Analysen gibt, aber er spielt im lösungsorientierten Therapiegespräch keine entscheidende Rolle. Steve de Shazer nennt es eines der großen Rätsel der lösungsorientierten Kurzzeittherapie, dass die detaillierte Untersuchung und Analyse des Problems auf die Lösungsfindung keinen Einfluss hat. Probleme und Lösungen eines Klienten beschreibt de Shazer in Verhaltensmustern. Es gilt die Annahme, dass Probleme einfach die Tendenz haben, sich selbst zu erhalten. Diese Selbsterhaltung wird durch ihre mehrmalige Beschreibung noch gefördert. Ein Problem ist jeweils ein bestimmtes Verhaltensmuster, das sich eingespielt hat. Der Kurzeittherapeut macht sich im Gespräch nun auf die Suche, Verhaltensweisen zu finden, die dieses Muster unterbrechen. In dem sich der Therapeut präzise und detailliert Situationen beschreiben lässt, in denen das Problem nicht da war, sucht er nach Verhaltensweisen, Handlungen, die dem Problemmuster nicht folgen. Ist eine Handlung, eine Verhaltensweise gefunden, die für den Klienten eindeutig zum Bereich der Ausnahme vom Problem und damit zur Lösung gehören gefunden, wird angenommen, dass diese einzige Handlung des Lösungsmusters das Problemmuster durchbrechen und verändern kann.
Steve de Shazer und sein Team verdeutlichen diesen Ansatz mit dem Beispiel eines Ehepaares, das im Therapiegespräch von ihrem zehnjährigen Sohn berichtet, der regelmäßig bettnässt. In der Interviewsituation erforscht nun der Therapeut gemeinsam mit dem Ehepaar und den beiden Kindern das Feld der Ausnahmen, wann und in welchen Situationen das Bettnässen des Sohnes nicht vorgekommen war. Vater, Mutter und Sohn fanden keine Ausnahmen; aber die sechsjährige Tochter wies darauf hin, dass der Junge immer Mittwochs, wenn er vom Vater geweckt wurde, nicht das Bett genässt hatte. Darauf hin wurde, nach dem die beiden Kinder aus der Therapiesitzung verabschiedet wurden mit den Eltern abgemacht, dass der Junge in den nächsten Tagen regelmäßig vom Vater geweckt werden sollte. Diese Musterdurchbrechung genügte in diesem Fall, um das Problem des Bettnässens zu lösen.
Aber was geht den hier vor?
Für einen Therapeuten, der es gewohnt ist, Probleme, psychische Störungen und Krankheiten, Traumata durch Ursachenforschung zu bearbeiten und zu heilen, mag dieses Vorgehen reichlich sonderbar sein. Steve de Shazer betont hingegen, dass für die Fortdauer eines Problems immer der Kontext, in dem dieses Problem besteht, zu beachten ist. Das heißt, ein Problem bedeutet immer ein Problemverhalten und zum Verhalten gehören Gefühle, Gedanken, Wahrnehmungen und bestimmte eigene und fremde Verhaltensweisen, die das Problem beeinflussen. Kann nun ein Teil dieses Problemverhaltensmusters geändert werden, wird dies notwendigerweise das Gesamtmuster beeinflussen.
Konstruktivismus
De Shazer unterscheidet in seinem Buch die Erforschung der „Familie als System“ und der „Therapiesitzung als System“. Mit dem Begriff der „Familie als System“ verbindet er jene Theoriemeinungen, die von Familie als einem objektiv beobachtbaren System ausgehen, das in seinen negativen oder positiven Strukturen erkannt werden kann. De Shazer arbeitet in der lösungsorientierten Kurzzeittherapie nicht mit dieser Annahme. Er geht in seinen Überlegungen von der „Therapiesitzung als System“ aus. Nur diese ist für ihn Gegenstand der Beobachtung und des Reflektierens. Therapeut und Klientin erzeugen/konstruieren in der Therapiesitzung eine gemeinsame Wirklichkeit, die in Richtung Neukonstruktion von vormals problematischen Aspekten verändert werden kann.
Besucher – Klagende – Kunden
De Shazer unterscheidet in seinem Buch drei Arten von Klienten, die in einem Therapiegespräch grundsätzlich zu finden sind. Diese Unterscheidung ist für ihn insofern von großer Bedeutung, da die Einschätzung des Klienten durch die Therapeutin in diesem Sinne von weitreichender Bedeutung für den Verlauf des Therapiesgesprächs ist. Als Besucher bezeichnet de Shazer Klienten, die keine noch so wage Beschwerde äußern. Mit ihnen kann eigentlich kein Therapiegespräch begonnen werden, da sie jede Intervention zurückweisen würden. Wer für sich gesehen kein Problem hat, wird auch keines mit einem noch so kompetenten Gesprächspartner lösen, auch dann nicht, wenn für einen Beobachter das Problem vielleicht offenkundig ist. Immer dann, wenn Klienten von anderen (Gerichte, Eltern, EhepartnerInnen, SozialarbeiterInnen usw.) geschickt werden, können solche Situationen entstehen. „In einer solchen Situation ist es für einen Therapeuten wohl sinnvoller, sich besuchen zu lassen, und nicht zu versuchen, diese unfreiwilligen Klienten davon zu überzeugen, dass sie eine Therapie brauchen.“ De Shazer empfiehlt solchen Besuchern einfach einige authentische Komplimente zu machen und ihnen keine Aufgabe zu stellen.
Eine zweite Kategorie von Klienten sind die „Klagenden.“ Jedes Therapiegespräch im eigentlichen Sinn beginnt mit einer Klage, einer Beschwerde. Wird eine Klage oder Beschwerde vorgebracht, so kann mit der therapeutischen Arbeit begonnen werden.
Die dritte Kategorie von Klienten nennt de Shazer Kunden. Sie lassen im Verlauf des Gesprächs erkennen, dass sie ernsthaft bereit sind gegen den Problemzustand etwas zu unternehmen.
Expertensystem
Ein weiteres Anliegen ist für de Shazer das Anlegen einer Theoriekarte für das therapeutische Gespräch. Diese Theoriekarte entsteht einerseits durch die konsequente Beobachtung des Therapiegesprächs über den Weg der Ausnahmen hin zur passenden Aufgabe für den Klienten zur Lösung. Andererseits ist diese Theoriekarte des therapeutischen Interviews selber ein Instrument für die disziplinierte Beobachtung lösungsfokusierter Interviews. Das Team um de Shazer hat nun ein Expertensystem (Computerprogramm) entwickelt, das mit Hilfe eines Fragestammbaums, den der Therapeut aufgrund der Gesprächsinformationen über den Klienten beantwortet, den Weg zur Lösung konsequent unterstützt und mögliche Handlungsalternativen aufzeigt. „Hinter diesem steckt die Idee, das Wissen des Teams im BFTC besser zu vermitteln und expliziter zu machen.“ Die verschiedenen Versionen der Fragestammbäume funktionieren entweder mit einer „wenn dies, dann das“ oder mit einer „wenn dies, dann das nicht“ Logik. Die vier Grundfragen nach dem die Theoriekarte des lösungsorientierten Gesprächs gegliedert ist lauten:
1. Gibt es eine Beschwerde? (Ja/Nein)
2. Gibt es eine Ausnahme? (Ja/Nein)
3. Gibt es ein Ziel? (Ja/Nein)
4. Besteht ein Zusammenhang zwischen Ziel und fortgesetzter Ausnahme? (Ja/Nein)
Steve de Shazer möchte keinesfalls die Therapeutin überflüssig machen. Der Fragestammbau dient lediglich dazu, dem Therapeutenteam ein Raster zur Verfügung zu stellen, dass fähig ist, die Beobachtungen und das Denken im Klientengespräch zu strukturieren. Voraussetzung für dieses Expertenprogramm ist die Entdeckung von Ähnlichkeiten in lösungsfokusierten Therapiegesprächen. Die Aufmerksamkeit der Beobachtung des lösungsorientierten Therapiegespräch richtet sich auf die Art und Weise, wie „Therapeut und Klient das Interview konstruieren“ und nicht so sehr darauf, worüber gesprochen wird. Aufgrund dieser Form der Beobachtung ist es de Shazer auch möglich, Gespräche mit ganz unterschiedlichen Problemanliegen zu vergleichen. De Shazer vergleicht nicht die Inhalte, oder die gefundenen Lösungen der Gespräche, sondern die gewählte Form des Gesprächsverlaufs.
Vertrauen in die Ressourcen- und Lösungskompetenz der Klienten
Grundlage des Vorgehens von de Shazer und seinem Team in einem Therapiegespräch ist die Voraussetzung, dass die Klientin aufgrund ihrer biologischen, psychischen und sozialen Ressourcen eine eigenständige Lösung entwickeln kann. Das möglichst schnelle Fokusieren auf Ausnahmen vom Problem und auf Zielvisionen soll dies ermöglichen, nämlich verdeckte Handlungsressourcen freizulegen.