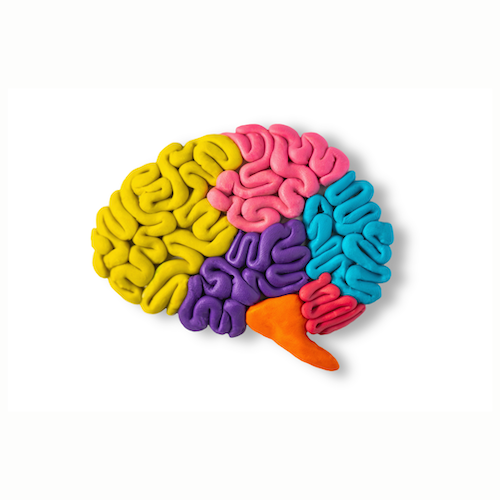Gedanken zum Buch von:
Hüther Gerald; Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, 92010 Göttingen.
Der Neurobiologe Gerald Hüther stellt sich, für einen Naturwissenschaftler und Gehirnforscher, in seinem Buch eine sehr ungewöhnliche Aufgabe. Er bemängelt, dass die Frage: Was sollen wir mit unserem Gehirn machen? bisher in der Gehirnforschung zu kurz gekommen sei. Die Beschäftigung mit Aufbau und Funktionsweise des Gehirns hat bisher den Vorrang eingenommen, auch in der Arbeit des Autors. Gerald Hüther möchte nun aufgrund der neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung auch die Frage nach dem „soll“ beantworten.
Die Grundlage seines Buches ist die fundamentale neurobiologische Erkenntnis, „dass das Gehirn zeitlebens zur adaptiven Modifikation und Reorganisation seiner einmal angelegten Verschaltungen befähigt ist.“ Das Gehirn ist ein Organ, dass sich seinen Nutzungsbedingungen zeitlebens anpasst. Damit stellt sich für Hüther und für den Menschen aber grundsätzlich die Frage: Wie das Gehirn eben zu nützen sei.
Aus neurobiologischer Sicht hat jedes menschliche Gehirn seine Begabungen und Schwächen, d.h. seine Prädispositionen; dass besagt aber noch lange nicht, dass damit die Entwicklung des menschlichen Gehirns eine vorgegebene Sache ist. Es gibt Prädispositionen (Veranlagungen) und Vulnerabilitäten (Anfälligkeiten), wie sich aber ein menschliches Gehirn letztlich konkret entwickelt, wird durch die Nutzungsbedingungen entschieden. Damit ist im Bereich der Hirnforschung die im 20. Jhdt durch Raymond y Cajal entstandene Hypothese von der Unveränderlichkeit der einmal im Gehirn entstandenen Verschaltungen überwunden.
Die Entwicklung des menschlichen Gehirns
Der Autor beschreibt in den 6 Kapiteln des Buches die phylogenetische, die ontogenetische und die aktualgenetische Entwicklung des menschlichen Gehirns. Grundsätzlich unterscheidet er so genannte „programmgesteuerte, initialgesteuerte und zeitlebens programmierbare Gehirne.“ Was ist damit gemeint?
Die phylogenetische Entwicklung des menschlichen Gehirns.
Die Entwicklung des Gehirns war in der Evolution durch verschiedene Einflüsse bedingt. Zum einen war es immer die Funktion des Gehirns, die innere Ordnung des Organismus aufrechtzuerhalten. Das bedingte andererseits wiederum die Entwicklung einer immer sensibleren Wahrnehmung äußerer Gefahren, um diese Ordnung zu gewährleisten. Im Laufe der Evolution entwickelten sich also Gehirne, deren neuronale Verschaltungen das Leben besser sicherten, indem Gefahren gegen den Organismus schneller erkannt wurden.
Die Kontextbedingungen in dem sich das Leben der Organismen entwickelten waren ein weiteres Ingrediens für die Entwicklung des Gehirns. Wurden Nischen oder parasitäre Überlebensplätze gefunden, die das Überleben leicht sicherten, so stellte sich die evolutionäre Entwicklung des Gehirns auf diese Umweltbedingungen ein. Diese Spezialisten der Evolution generierten ein Gehirn, dass aufgrund der jeweiligen Kontextbedingungen der Nische das Überleben am besten sicherten. Hüther führt das Beispiel des Bandwurms und des Maulwurfs an. Beide Tiergattungen fanden eine Nische, die in evolutionärer Hinsicht die Entwicklung des Gehirns maßgeblich beeinflussten, mit dem Nachteil, dass sich das Gehirn dieser Arten so spezialisierte, dass ein Überleben in einem anderen Kontext irgendwann nicht mehr möglich war. „Je einseitiger diese Bedingungen sind und je besser dieser Anpassungsprozess gelingt, desto schwerer fällt es ihnen allerdings, später einmal wieder aus so einer Nische herauszukommen.“
Eine andere evolutionäre Möglichkeit der Benutzung des Gehirns mussten jene Arten entwickeln, denen es nicht gelang in einer Nische Fuß zufassen und deren Umwelt so komplex und unsicher war, dass alle Fähigkeiten des Gehirns gleichermaßen beansprucht werden mussten. Diese dritte Art der evolutionären Benutzung des Gehirns führte letztlich zu einer Gehirnkonstruktion, die zeitlebens offen ist, sich den Nutzungsbedingungen der Umwelt anzupassen.
Am Anfang der Evolution stehen also programmgesteuerte Gehirne, deren Verschaltungen genetisch festgelegt sind und nicht mehr verändert werden können. Eine weitere Stufe der Entwicklung stellen initial-programmierbare Gehirnstrukturen dar. In diesen Gehirnen kommt ein Teil der neuronalen Verschaltungen durch führe Erfahrungen zustande. Das was allgemein mit Tierinstinkten gemeint ist, sind meist früh eingegrabene Erfahrungen, die Tiere bei der Bewältigung von Stresssituationen gemacht haben. Das berühmte Grauganzexperiment von Konrad Lorenz ist ein bekanntes Beispiel einer initialgesteuerten Gehirnprogrammierung bei diesen Tieren. Die Erfahrungen der ersten Lebenstage bestimmen das lebenslange Verhalten.
Damit sich aber in der Evolution jene dritte Art von Gehirnstruktur, wie sie der Mensch ca. seit 100.000 Jahren besitzt, durchsetzen konnte, brauchte es spezielle Nutzungsbedingungen. Zum einen müssen es Kontextbedingungen gewesen sein, die ein komplexes Denk- und Wahrnehmungsvermögen zum Überleben erfordert haben. Damit wurden die neuronalen Verschaltungsmöglichkeiten beständig erweitert. Die ständige Veränderung von Umweltbedingungen förderte eine Gehirnstruktur, die sich immer länger als formbar erweisen musste. Das ständige Hinauszögern des Festlegens der neuronalen Verschaltungen erforderte wiederum möglichst lange Sicherheit in der Entwicklung und somit einen guten Zusammenhalt in der Sippe. So konnten auf Dauer nur jene Primaten überleben, die durch ihr soziales Verhalten das Überleben der Sippe gewährleisten konnten. Das Ergebnis dieses evolutionären Prozesses war ein zeitlebens lernfähiges Gehirn, das nur der Mensch ca. seit 100.000 Jahren besitzt.
Die ontogenetische Entwicklung des menschlichen Gehirns
Über die konkrete Entwicklung des menschlichen Gehirns entscheiden die Nutzungs- und Umweltbedingungen. Je differenzierter und optimaler die Nutzungsbedingungen für das menschliche Gehirn sind, desto mehr miteinander verschaltete Nervenzellen werden entstehen.
Bereits in der Entwicklung im Mutterleib entscheiden Umweltbedingungen und Nutzungsbedingungen, die die Mutter vorfindet über Entwicklungschancen des Gehirns. Sowohl die Aufnahme von Wirkstoffen wie Alkohol, Nikotin usw wie auch die „Veränderung der Konzentration bestimmter…Hormone, die durch seelische oder körperliche Belastungen während der Schwangerschaft ausgelöst werden, können die Hirnentwicklung beeinflussen.“
Nach der Geburt muss das Neugeborene den Stress und die Angst bewältigen. Dazu braucht es in den ersten Lebensjahren sichere Bindungen zu vielen unterschiedlichen Menschen, damit das Gehirn differenzierte Verschaltungen und Stressbewältigungsmuster generieren kann. Gerade die erste Lebensphase des Neugeborenen ist besonders wichtig, da viele neuronale Verschaltungen erst ausgeprägt werden. Wenn das Neugeborene genügend sichere Bindungen aufbauen kann, hat es die Möglichkeit, „viel von dem zu spüren und wahrzunehmen, was es bereits aus seinem bisherigen Leben im Mutterleib kennt.“
Das Problem sind meist Umwelt- und Nutzungsbedingungen durch die zum Teil sehr unsichere und/oder zu wenige Bindungen, aufgebaut werden können. Dadurch steigt die Möglichkeit, dass das Gehirn einseitige Strategien der Angstbewältigung festlegt, die später nur mehr schwer gelockert werden können. Hüther benutzt das Bild des Pfahlwurzlers für einen Bindungstyp, der nur sehr wenige und sehr enge Bindungen aufbauen konnte. Die allzu feste Bindung an nur wenige kann die Neugier auf die Welt und die Entdeckungslust massiv beeinträchtigen. Diejenigen Menschen, die in ihrer Kindheit zwar viele aber sehr unsichere Bindungen erlebt haben, bezeichnet Hüther als Flachwurzler, denen es schwer fällt intensivere Bindungen einzugehen.
In der Spannung zwischen Gefühl und Verstand
Anhand der Spannungsbögen von Gefühl und Verstand, Abhängigkeit und Autonomie und Offenheit und Abgrenzung markiert Hüther sowohl optimale als auch eingeschränkte Nutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des menschlichen Gehirns.
In der Entwicklung des menschlichen Gehirns kann es zu einer Unausgewogenheit von Gefühl und Verstand kommen. Der Gefühlsmensch ist geprägt durch eine enge Bindung an die Mutter oder an eine andere Beziehungsperson. Menschen, die rational entscheiden, standen während der prägsamen Entwicklung des Gehirns nicht zur Verfügung und konnten somit die entsprechen neuronalen Verschaltungen nicht fördern. Solche Menschen entscheiden und handeln sehr intuitiv und gruppenbezogen. Menschen hingegen, die einen Mangel an Zuwendung und an emotionaler Sicherheit erhalten haben, haben diesen oft durch eine verstärkte Selbstbezogenheit und Rationalität kompensiert.
Autonomie und Abhängigkeit
Die zureichende Stabilität und Sicherheit von Bindungen entscheiden in den ersten Lebensjahren, welches Verhältnis der Mensch zu Autonomie und Abhängigkeit einnimmt. Grundsätzlich sollte für eine optimale Entwicklung des menschlichen Gehirns die Bindung an die Bezugsperson so sicher sein, dass dem Kind Schritt für Schritt die Entdeckung der Welt möglich wird. Ist diese Bindung zu eng, führt sie in die Abhängigkeit und dem Gehirn fehlen die notwendigen Nutzungsbedingungen für seine Entwicklung. Ist die Bindung zu instabil aufgrund der Erfahrung von mehr oder weniger schweren Vertrauensbrüchen, „können diese Destabilisierungsprozesse lebensbedrohliche Ausmaße annehmen“, die nur noch durch Abkoppelung der traumatischen Erfahrungen bewältig werden können.
Zwischen Offenheit und Abgrenzung
Manche Kinder kommen mit einer schier unbegrenzten Neugier und Offenheit verbunden mit einem starken Bewegungsdrang zur Welt. „Diese Kinder neigen dazu, mehr in sich aufzunehmen, als sie tatsächlich verarbeiten.“ Sie brauchen eine strukturierende Umgebung, damit sie sozusagen in der Flut der Eindrücke nicht ertrinken. Andere Kinder wiederum lassen sich von Anfang an von äußeren Reizen nur schwer beeindrucken. Sie verharren bereits als Baby wie ein kleiner Buddha inmitten des Wohnzimmers. Zu stark verschlossene Kinder laufen aber Gefahr, zu wenig von der Welt mitzukriegen. Sie brauchen eine Umgebung, die sie dementsprechend herausfordert.
Die richtige Benutzung des Gehirns
Wäre das Gehirn von uns Menschen so fest verdrahtet wie das eines Maulwurfs, müssten wir uns, so Gerald Hüther, keine Gedanken über die Anwendung unseres Gehirns machen, denn es gäbe nichts zu entscheiden. Die genetische Programmierung hätte uns die Entscheidung abgenommen. Beim Menschen ist es aber nicht so und das ist das spannende daran. Der Mensch kann sich frei entscheiden wofür er sein Gehirn benutzen will. Paradoxerweise bleibt ihm diese Freiheit je mehr, desto mehr er sich bewusst für die Art und Weise der Nutzung entscheidet. Das Gehirn des Menschen ist ein lebenslanges offen programmierbares System. Diese freie Entscheidung der Nutzung des Gehirns hat natürlich seine Einschränkungen. Wenn die ontogenetischen Entwicklungsbedingungen auf ein Minimum reduziert waren, wird es einem Menschen nur in sehr bedingtem Ausmaß gelingen, über die Nutzung seines Gehirns frei zu entscheiden. Auch in bedrohlichen gesellschaftlichen Situationen, wenn bspw. Menschen ihre ganz Energie aufwenden müssen, um nur zu überleben, ist der Entscheidung über die Entwicklung des eigenen Gehirns eine Grenze gesetzt. Aber auch mangelndes Wissen über die Arbeitsweise des Gehirns kann die freie Entscheidung beeinträchtigen.
Die kulturelle Entwicklung im Lauf der Geschichte war immer wieder bestimmt, die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu erreichen. Zu diesem Zweck haben Menschen Gemeinschaften und Kooperation entwickelt. War das Ziel erreicht zerfielen diese sozialen Gefüge aufgrund des Nachlassens der Anstrengungen bis zu jenem Zeitpunkt, an dem neue Bedürfnisse auftauchten. Diese kulturellen Zyklen gingen aber nicht spurlos in der genetischen Entwicklung unseres Gehirns vorbei. Sie wurden auch über Generationen abgespeichert. So kam es zu einer ständigen Erweiterung der Nutzung des Gehirns im Bereich der Wahrnehmung, der Erkenntnis und des Selbstbewusstseins.
Wahrnehmung
Hüther erwähnt, dass es in jeder Kultur immer besonders mutige Menschen gab, die die Vorreiterrolle übernommen haben, in der Art und Weise wie sie ihr Gehirn benutzten. Hüther nennt sie auch Propheten. Sie zeichneten und zeichnen sich dadurch aus, dass sie innere und äußere Wahrnehmung zugleich schulten. So wurde ihr Gehirn fähig immer neue Bilder mit den alten zu verbinden und verschmelzen zu lassen. Diese Erweitung der Wahrnehmung des Gehirns geht nicht von selber. Sie braucht Muße, ein stabiles inneres Gleichgewicht, ein störungsfreies Umfeld und einen festen Willen. Die Stufenleiter der Wahrnehmung hinab zu steigen, das geht von selber. Hinauf geht´s nur mit Konsequenz.
Empfindungen
Unser Gehirn macht sich ständig ein Bild von den äußeren und inneren Geschehnissen und versucht immer wieder die innere Ordnung herzustellen. Zwei Grundgefühle begleiten den Mensch dabei. Die Angst ist das Gefühl, wenn etwas nicht passt in diesem Gleichgewicht und die Freude ist das Empfinden über die wieder gewonnene Ordnung. Die Empfindung der Überraschung fügt Hüther als dritte Grundkonstante besonders für den Menschen hinzu. Auch in diesem Bereich ist das menschliche Gehirn fähig, seine Nutzung auszubauen. Für Kinder ist es entscheidend, ob sie in einer Umgebung aufwachsen, die das differenzierte Ausdrücken von Gefühlen fördert oder hindert. In hohem Maß Basis dafür ist das Vorhandensein von sicheren Bindungen.
Erkennen
Die Fähigkeit zu Erkennen ist eine relativ spät entwickelte Funktion des menschlichen Gehirns. Als primäre Stufe des Erkennens nennt Hüther die Fähigkeit „wenn-dann“ Beziehungen und Erkenntnisse herzustellen. Diese primäre Stufe der Erkenntnis wird aufgebrochen durch die Fähigkeit, komplexe Strukturen zu erkennen und zu sehen, dass es nicht nur monokausale Verursachungen gibt, sondern dass viele Bedingungen die Ursache eines Zustandes sein können. Als dritte Stufe der Erkenntnis, nennt Hüther die Fähigkeit, dass der Menschen erkennen kann, dass alles was er tut, Spuren hinterlässt.
Bewusstsein
Mit dem Begriff Bewusstsein beschreibt Hüther die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu beobachten, sich seiner selbst in Gedanken, Handlungen und Empfindungen bewusst zu werden. Auch das Bewusstsein hat eine materielle Grundlage in den neuronalen Verschaltungen des Gehirns. Das Gehirn hat sozusagen eine Metaebene an Verschaltungen. Die Entwicklung des Bewusstseins ist eng verknüpft mit den Stufen der Entwicklung in den anderen Bereichen Wahrnehmung, Gefühle und Erkenntnis.
Durch das Heraustreten aus Bindungen entsteht und entwickelt sich sowohl auf phylogenetischer wie auch auf ontogenetischer Ebene menschliches Bewusstsein. Kulturgeschichtlich datiert Hühter das Heraustreten des Menschen aus dem kollektiven mythischen Bewusstsein ca. vor 6000 Jahren. Einen ersten deutlichen Ausdruck findet dieses Heraustreten im Gilgamesch-Epos, der die Heldentaten des Königs Uruk schildert. Aber auch in der ontogenetischen Entwicklung eines Menschen braucht es das langsame Durchwandern des „kindlich-mythischen“ Bewusstseins hin zu einem festen Selbstbewusstsein. Es gibt in der Entwicklung sowohl die Gefahr einer vorschnellen pseudoautonomen Selbstbezogenheit wie auch das Verharren im mythischen Zustand des Bewusstseins. Grundsätzlich hat der Mensch die Fähigkeit zur Transzendenz, das heißt, dass es ihm möglich ist, vorgegebene Bewusstseinszustände und Identitäten immer wieder zu hinterfragen und zu überschreiten. Als Ziel nennt Hüther eine Persönlichkeit, die mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein verlässliche Beziehungen und Bindungen herstellen kann.
Das Ziel und der Weg dorthin
Als grundsätzliches Ziel aller bewussten Nutzungsmaßnahmen für das menschliche Gehirn nennt Hüther die Freiheit. Es geht darum, dass es dem Menschen nicht wie dem Bandwurm im Darm gehen soll, der aufgrund der bequemen Lebens- und Nutzungsbedingungen im Lauf der Evolution letztlich sein Gehirn völlig abgebaut hat. Auf dem Weg zur Erhaltung und Erweiterung dieser Freiheit nennt Hüther zum einen die Bedingungen, dass der Mensch immer wieder seine Ziele zu überdenken hat und bereit sein muss, sie auch zu ändern. Weiters ist es die Achtsamkeit, die als grundlegende Wartungsmaßnahme für ein auch in Zukunft funktionierendes Gehirn beachtet werden soll. Als letzten Punkt nennt Hüther die Fähigkeit zur Betroffenheit, die sich der Mensch erhalten muss, um weiterhin die Nutzungsbedingen seines Gehirns zu erweitern. Nur wenn sich Menschen betroffen fühlen, von Umständen, Lebensbedingungen und anderen Menschen, werden sie aufgrund dieser Betroffenheit beginnen, Ziele, Lebensweisen und Haltung zu ändern. Für Hüther ist das menschliche Gehirn in erster Linie ein Sozialorgan, dass die Fähigkeit besitzt, Kooperationen und gemeinsame Ziele zu organisieren und auf dem Weg dorthin immer wieder eingefahrene Wege zu verlassen und einmal entstandene Programmierungen wieder aufzulösen.
„Der Prozess der Menschwerdung ist noch gar nicht abgeschlossen, und wir haben die Möglichkeiten der Entfaltung und Nutzung unseres Gehirns offenbar noch lange nicht ausgeschöpft.“